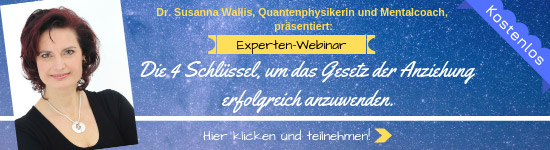Unser Selbstbild und die äußere Wahrnehmung.
von Dr. Sanita Schröer -
Vom künstlichen Selbstbild zur eigenen Bestimmung.
Die Art, wie wir uns selbst sehen, beeinflusst, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen und wie wir mit ihr in Beziehung treten. Unser Selbstbild bestimmt also, wie wir unsere äußere Welt wahrnehmen. Diese Wahrnehmung wiederum scheint uns die Fragen zu beantworten:
? „Wer bin ich?",
? „Wer sind die anderen Menschen?“ und
? „In welcher Beziehung stehe ich zu ihnen?"
Unser Selbstbild verleiht uns durch diese Fragestellungen eine nützliche Identität, mit der wir uns in unserem Alltag zurechtfinden.
So mag es nicht verwundern, wenn wir unser Selbstbild dadurch zu stärken trachten, dass wir uns bewusst oder unbewusst immer wieder mit Menschen umgeben, die ähnliche Ansichten über das Leben haben wie wir. Im Zusammensein mit ihnen empfinden wir in der Regel Harmonie und Freude, so dass dies der Personenkreis ist, innerhalb dessen Freundschaften geschlossen werden.
Unbewusst schließen wir mitunter Freundschaften mit diesen Menschen, weil sie unser Selbstbild bestätigen und es nicht in Frage stellen.
So erstaunt es nicht, wenn wir uns oft fernhalten von anders denkenden Menschen, die unser Selbstbild in Frage stellen könnten oder wenn sie uns nicht angenehm sind. Mitunter fühlen wir uns durch ihre abweichenden Ansichten in unserem Selbstbild verunsichert bis hin zu manchmal sogar bedroht. Das Andersartige, das Fremde wird in diesem Fall betont.
Doch sobald wir uns stark mit unserem Selbstbild identifizieren, da es permanent bestätigt wird, kann es sein, dass wir irgendwann unreflektiert glauben zu wissen, wer wir sind – besser noch, es verleiht uns eine erwünschte Identität. Die Vertrautheit mit unserem Selbstbild verschleiert zudem, dass es sich nur um eine von vielen verschiedenen Wahlmöglichkeiten handelt, die wir in der Regel nicht durch eigene Entscheidungen selbst gewählt haben.
Sie wurden überwiegend als erwünschtes Verhalten bereits in frühester Kindheit und im Laufe des Erwachsenwerdens an uns herangetragen. Wir haben mehr oder weniger gut gelernt, diesen Erwartungen zu entsprechen.
So leben wir heute überwiegend im Vergessen über unsere wahre Natur. Wir wissen nicht, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen; uns fehlt die Selbsterkenntnis dazu. Um jedoch alltagstauglich zu sein, leben wir oft ein Leben lang mit einer künstlich erschaffenen Identität, ohne uns unserer Täuschung, der wir unterliegen, bewusst zu sein.
Wir hinterfragen unsere Identität selbst dann nicht, wenn irgendetwas in unserem Innersten widerspricht und sagt, „da stimmt was nicht“. So leben wir unser Leben umgeben von Menschen, die uns anerkennen und die uns ihre Aufmerksamkeit schenken. Dies geht einher mit ungeprüften Vorstellungen darüber, wie wir glauben, sein zu müssen und wie wir uns vorstellen, dass andere uns haben wollen. Und nicht wenige Menschen sind ihr Leben lang darum bemüht, diesen Vorstellungen zu entsprechen.
Allerdings erhalten wir unser künstliches Selbstbild nicht ausschließlich durch die Bestätigung anderer Menschen am Leben. Wir haben ebenso verlässliche Mitstreiter in uns selbst. Gemeint sind unsere oft wiederkehrenden und auch gleichförmigen Gedanken und das in unserem Inneren permanent ablaufende Selbst- und Zwiegespräch.
Mit unserem Selbstgespräch erzählen wir uns unentwegt, dass die Welt so ist, wie sie uns erscheint. Das gelingt, solange wir uns in unserer gewohnten Routine bewegen. Wollen wir jedoch unsere Gedanken beruhigen und einmal die Stille genießen, ausgerechnet dann überkommt uns scheinbar aus dem Nichts eine rege Gedankenflut.
Man könnte fast meinen, dies sei eine Strategie unseres Verstandes, die Routine aufrecht zu erhalten, damit unser künstliches Selbstbild nicht ins Wanken gerät. Denn solange wir nicht bereit sind, unser künstliches Selbstbild aufzugeben, um zu erfahren, wer wir wirklich sind, solange ist die Stille gefährlich.
Denn die Stille könnte uns in Kontakt bringen mit dem einzigartigen Wesen, das wir wirklich sind.
Dafür brauchen wir allerdings wirklich die Bereitschaft, gewohnte Denk- und Verhaltensmuster zu überdenken sowie die Bereitschaft, für Entwicklung offen zu sein. Liebgewordene Gewohnheiten loszulassen und den Weg für neue Erfahrungen frei zu machen, kommt uns jedoch meist nur unter Leidensdruck in den Sinn. Dabei existiert hinter der regen Gedankentätigkeit unseres Verstandes diese Stille, mit der in Kontakt zu kommen sich lohnt.
Wer es schon einmal geschafft hat, seine Gedankenflut so zu beruhigen, dass er den Zustand eines tiefen, inneren Schweigens erfährt, der erlebt diese Stille so, als würde sie die Seiten in uns sichtbar machen, bei denen es so scheint, als hätte unser Verstand sie bis zu diesem Zeitpunkt streng bewacht.
In der Stille nehmen wir Seiten in uns wahr, von denen wir nicht gedacht hätten, dass sie ebenfalls Teil von uns sind. Hier beginnt die Reise in unsere Wesenstiefe zu dem Wesen, das wir wirklich sind. Hier kommen wir mit einer Wirklichkeit in Kontakt, die zu erfahren uns jenseits des Verstandes möglich ist. Dazu eine freie Erzählung aus „Der Adler, der nicht fliegen wollte“ von James Aggrey:
Ein Adler wuchs auf einer Hühnerfarm unter Hühnern auf. Er übernahm ihre Lebensweise und ihre Gewohnheiten. Er lief am Boden herum und pickte Körner wie sie und bemühte sich nach besten Kräften, ein gutes Huhn zu sein.
Eines Tages kam ein alter Adler vorbei. Er sagte dem jungen Adler er sei kein Huhn, er sei ein Adler. Der junge Adler stritt das ab. Sich mit einem so majestätischen Wesen zu vergleichen erschien ihm hochmütig. Schließlich war er doch ein Huhn. So ging der alte Adler mit ihm zu einem Teich und wies ihn an, hineinzuschauen.
Dies tat der junge Adler und er war schockiert. Er sah ganz anders aus als die anderen Hühner und das machte ihn traurig. Er wollte doch zu den anderen dazu gehören. Und so war er dankbar, dass die anderen Hühner ihn als ihresgleichen akzeptierten.
Die Sonne schien am Himmel und so befahl der alte Adler ihm, in die Sonne zu sehen. Da der junge Adler es beim Körnerpicken gewohnt war gebückt zu gehen, hatte er das noch nie gemacht. Und als die Sonnenstrahlen seine Augen berührten und er das Licht der Sonne in sich aufnahm, erinnerte er sich an sein wahres Wesen. Er stieß den Anmut und Freiheit bekundenden Adlerschrei aus, erhob sich in die Lüfte und wurde nie mehr auf der Hühnerfarm gesehen.
Geht es uns wie dem jungen Adler?
Haben wir vielleicht vergessen wer wir sind und klammern uns an das, was wir glauben zu sein, weil es uns vertraut ist und uns Sicherheit gibt?
Kann es sein, dass auch in uns ein anmutiges Wesen schlummert? Kann es sein, dass wir, wie der junge Adler, an unserer Bestimmung vorbei leben, weil wir uns nicht erinnern, wer wir wirklich sind?
Wir haben gelernt, unser künstliches Selbstbild so sehr für die Wirklichkeit zu halten, dass die Frage „wer bin ich?“ nur alle möglichen zur Gewohnheit gewordenen Rollen und Identifikationen offen legt. So schaffen wir uns Illusionen unser ganzes Leben lang.
Oberflächlich betrachtet scheinen wir damit mehr oder weniger erfolgreich zu sein. So streben wir immer wieder neu danach, unser künstliches Selbstbild zu stärken, da wir meinen, dass uns dies glücklich mache. Wir wissen es nicht besser. Erst durch viele Lebenserfahrungen wird uns langsam klar, dass es die Entfaltung unseres wahren Wesens ist, nach der wir uns wirklich sehnen.
So stellt manch einer von uns zu einem späteren Zeitpunkt fest, dass wir allein durch materielle Erfüllung unserer Träume weder Freiheit noch das Wesentliche in unserem Leben erfahren haben, nämlich das wunderbare Wesen in uns selbst. Und wir lernen vielleicht, dass Freiheit doch eher die Freiheit der Wahl ist, die Absichten unserer Seele zu spüren, unsere Wesenskräfte zu entfalten und unsere Bestimmung zu leben.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Gelingen!
Es grüßt Sie herzlich
Ihre Dr. Sanita Schröer