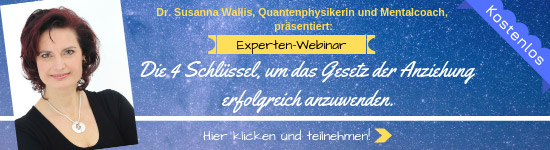Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
Eine Redensart, die in meinem Leben sicherlich näher liegt, als ich früher je gedacht hätte. Wie oft bin ich schon losgezogen, um etwas zu finden, dass ich dort, wo ich war, scheinbar nicht hatte oder gewiss nie finden könnte. Glücklicherweise begriff ich irgendwann, dass Frank Sinatra es auf den Punkt gebracht hat: „If you can make it there, you can make it anywhere“ (dt: Wenn du es dort schaffen kannst, kannst du es überall schaffen). Wir sind immer am richtigen Ort zur richtigen Zeit, um das zu lernen, was wir lernen sollen.
So war ich bei der Beobachtung jener Szene neulich selbst mal wieder überrascht, wo man überall Fundamentales begreifen kann.
Eine Frau saß in der Küche im Wohnhaus ihrer Eltern. Ihr Blick ging in Richtung Wohnzimmer, wo ihr Vater, ein Mann Mitte 70 und pflegebedürftig, auf seinem Sessel saß. Da ihm ein wenig das Gespür für Zeit abhanden gekommen war, fragte er an diesem Vormittag zum wiederholten Male, wie spät es jetzt sei. Bereits zwei Stunden vor der Zeit wäre er am liebsten aufgebrochen zum gemeinsamen Mittagessen. Irgendetwas in der Frau war unruhig. Die Geduld, die sie sonst an anderer Stelle meist hatte, schien ihr abhanden gekommen zu sein. Warum konnte er nicht einfach warten, bis der richtige Zeitpunkt gekommen war? Sicherlich, er hatte eben nicht mehr dieses Feeling dafür. Aber seine innere Unruhe schien sie anzustecken. Oder war sie es, die ihn ansteckte? Der Gedanke aber kam ihr nicht.
Ebenfalls in diesem Wohnzimmer befand sich ihr Neffe, sein Enkel. 15 Jahre alt und hauptberuflich Pubertierender laut seiner Mutter. Was ihn aber nicht davon abhielt, bei jeder Gelegenheit zu seinen Großeltern zu kommen. Wo er irgendwie recht wenig pubertierte (ein weiteres Geheimnis in unserem Leben, nicht wahr?). Jedenfalls fing sein Großvater an, wieder unruhig im Sessel zu ruckeln. Er wollte aufstehen, weil er (mehr als eine halbe Stunde zu früh) wieder loswollte, um ja nicht zu spät zu kommen. Die Frau war genervt. „Jetzt will er schon wieder aufstehen! Kann er nicht einfach noch ein wenig warten?“, seufzte sie innerlich, während sie von hinten ihrem Vater dabei zusah, wie er im Sessel nach vorne rutschte, um sich hochzuhieven. Sein Enkel blickte von seinem Handy auf. „Brauchst du was, Opa?“, fragte er freundlich. „Ja, ich will aufstehen“, meinte dieser und ruckelte weiter. Und während die Frau in ihrem inneren Genervtsein badete, stand ihr Neffe kurzerhand auf und half ihm hoch aus dem Sessel.
Es war dieser Moment, als sie begriff, was hier los war. Sie befand sich, einmal mehr, im Krieg. Mit den Menschen, die seit ihrer Geburt versuchten, sie zu lieben. Wie oft hatte sie diese Liebe nicht gewollt, erhofft, abgelehnt, erbettelt. Doch erst seit kurzem konnte sie fühlen, dass sie immer dagewesen war, in einem viel höheren Maße, als sie es je hätte ahnen können. Nun ertappte sie sich selber wieder dabei, dass sie es war, die innerlich Krieg führte gegen diese Liebe. Seltener, aber eben doch noch dann und wann. Jetzt war einer dieser Momente. Warum war sie nicht auf die Idee gekommen, ihm einfach aufzuhelfen, wenn er aufstehen wollte? Warum bekriegte sie stattdessen das, was war, in ihrem Kopf? Ihr Neffe zeigte ihr, auf die höchst einfachste und effektivste Art, was es bedeutete, für jemanden da zu sein. Es geht nicht darum, die Wünsche des anderen zu hinterfragen und sie zu beurteilen, ja, zu verurteilen. Wenn es einen Menschen gibt, der sich etwas wünscht, gibt es nichts Wertvolleres, als ihn dabei zu unterstützen. Punkt. (Ich klammere jetzt mal zerstörerische Dinge der Einfachheit halber aus)
Für einen kurzen Moment sah sie dieses Bild leuchten. Und sie wusste, sie würde es nie mehr vergessen. Der Fünfzehnjährige, der seinem Großvater aus dem Sessel hilft mit einem Lächeln im Gesicht. Mehr Guru, mehr Lehrer gab es nicht auf dieser Welt. Für diese Erkenntnis, die sie in diesem Moment durchflutete, brauchte sie nicht nach Indien zu reisen. Oder Tibet. Oder zum Schamanen nach Peru. Sie fand hier und jetzt statt, im Elternhaus, mit ihrem Vater und ihrem Neffen als die Menschen, die ihr zeigten, dass es an der Zeit war, mit den inneren Verurteilungen endlich aufzuhören. Von altem Schmerz ein für alle Mal abzulassen. Wenn es sein muss, eben wieder und wieder. Sie entschied sich dafür, künftig anders zu denken und all das dafür zu tun, was es bräuchte, damit sie es könnte. Dafür trug sie jetzt ein Bild in ihrem Herzen, für das sie sehr dankbar war und ist.
Natürlich ahnen Sie es längst. Diese Frau bin ich. Das Leben ist mein Lehrmeister, ja. Und ich teile meine Reise zu mir selbst mit den Menschen, die meine Geschichten hier lesen wollen. Vielleicht können diese beiden Männer unterschiedlicher Generationen ja so noch viele andere etwas lehren. Ich jedenfalls vergesse nie die Demut, die ich in diesem Moment gefühlt habe. Und bin der Liebe damit einmal mehr ein Stückchen näher gekommen. Es sind unser Denken und das durch das Denken hervorgerufene Fühlen, was uns davon abhält, die Schönheit, Wahrheit und Liebe in allem und jedem zu sehen. Es liegt in uns allein, wofür wir uns entscheiden. Auch brauchen wir uns nicht dafür zu schämen, dass wir noch nicht die Zielgerade durchschritten haben.
Wichtig ist es, unterwegs zu sein. Auf der Reise zu sich selbst, zur Wahrheit und der Liebe. Diese Reise findet genau dort statt, wo man gerade ist. Jetzt. Hier. Mit genau diesen Menschen, die uns umgeben.
Namasté, Guru Leben.